
Mineral- und Thermalwasser
sowie andere Wässerchen
Der Basel-Städter Julien Hediger ist seit zwei Jahren Food & Beverage Manager im Le Grand Bellevue Gstaad. Der 28-Jährige absolvierte die Hotelfachschule Lausanne und arbeitete anschliessend zweieinhalb Jahre im Ausland, unter anderem in Katar und auf den Seychellen. Er hat sich bei Gastrosuisse zuerst zum Bier-Sommelier und
anschliessend als Wasser-Sommelier ausbilden lassen.
Foto: Martin Gurtner-Duperrex
Wasser-Sommelier im Grandhotel
Als Wasser-Sommelier berät Julien Hediger im Le Grand Bellevue in Gstaad Gäste aus aller Welt bei der Wahl von Mineralwasser, wovon es sieben Sorten auf der Menükarte gibt. «Die meisten sind sich nicht bewusst, welche Unterschiede es zwischen den verschiedenen Wassersorten gibt und zu welchen Speisen sie passen», sagt er. «Als hundertprozentiges Naturprodukt, das in jedem Fall mehrere Jahre, manchmal bis zu 10 000 Jahre alt ist, verdient Mineralwasser aber mehr Interesse», so der Wasserprofi.
Je nachdem von welchem Ort das Wasser kommt und ob es stark oder schwach mineralisiert ist, habe es einen ausgeprägteren Geschmack. Auch die hinzugefügte Kohlensäure spiele eine Rolle.
So empfiehlt der Sommelier zum Kaffee oder Whisky eher Mineralwasser mit niedrigem Mineralgehalt ohne Kohlensäure, damit die Bitterstoffe und das Aroma besser nachwirken können. Ein absolutes No-Go ist für ihn aus demselben Grund ein kräftiger Rotwein mit Sprudelwasser, wogegen sich dieses mit einem jungen, spritzigen Weisswein durchaus verträgt. Bei scharfen und kräftigen Speisen ist zu beachten, dass Kohlensäure den Geschmack noch hervorhebt und deshalb ein stilles, niedrig mineralisiertes Wasser vorzuziehen ist.
«Beim Essen sind bei der Wahl des Mineralwassers jedoch persönliche Vorlieben und Gewohnheiten ebenso wichtig», stellt Hediger fest. So liebt er das hoch mineralisierte Wasser seiner Heimat Basel, mit dem er aufgewachsen sei.
Verdient seinen Preis: das Gstaader Bergtrinkwasser
Die meisten Restaurants im Saanenland bieten ihren Gästen Trinkwasser aus der Leitung an. Den Preis von vier, fünf bis acht Franken pro Karaffe oder Flasche (je nach Restaurant), mit oder Kohlensäure, erklärt der Präsident des Hoteliervereins Gstaad Saanenland und Gastgeber im Hotel Gstaaderhof, Christof Huber, mit den Servicekosten sowie der Aufbereitung wie Kühlen und Filtern. «Das ist deutlich billiger als ein Liter Mineralwasser», betont er. Die Gäste akzeptierten diesen Preis gerne, wenn sie die Gründe dafür verstünden.
So leiste man beim Trinken des Gstaader Bergtrinkwassers «einen aktiven Beitrag zum Schutz unserer Umwelt». 13 000 Liter Erdöl würden jährlich für die Transportkosten von Mineralwasser eingespart und die Energieaufwand für Produktion, Abfüllen, Etikettierung, Lagerung und
Entsorgung falle weg, so Christof Huber.
Apropos Leitungswasser: Die gemeindeeigenen Brunnen sind mit Plaketten versehen, die explizit darauf hinweisen, dass es sich um Trinkwasser handelt — und dieses ist natürlich weiterhin gratis.
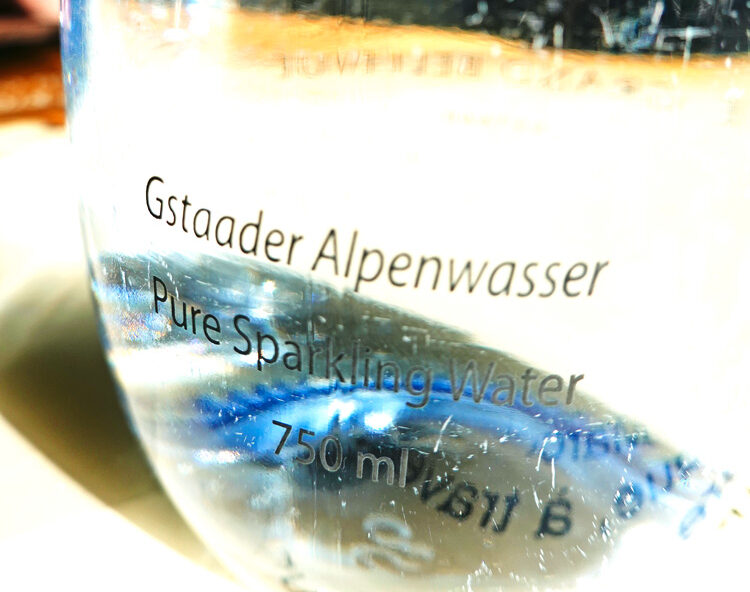
Im Le Grand Bellevue wird den Gästen das gesunde Trinkwasser aus der Region als «Gstaader Alpenwasser» angeboten.
Foto: Martin Gurtner-Duperrex

Schwefelbäder im Turbach, Badweidli und in der Lauenen
Es habe derart «umha gschmäckt, dass es zum Erbrechen war», schrieb Emanuel Friedli 1927 in seinem Geschichtsband über Saanen. Gemeint damit waren die hiesigen Schwefelquellen, die von den Saanern wegen der heilenden Wirkung ihres Wassers zum Baden bis ins späte 19. Jahrhundert besucht wurden.
Das Turbachbädli war gemäss Friedli seit 1500 bekannt. Im «Badhus Turpach», dass in der Chronik 1627 erwähnt wird, begegnete man «Badleüthen», die ihre Hautübel, Rheuma- und Magenleiden sowie Fettleibigkeit kurierten. Ein gemauertes Reservoir und einfache «Badchäste» wurden 1785 installiert. Nach verbotenen Trinkgelagen, Schlägereien unter Badegästen und Verstössen gegen die guten Sitten hatte das Saaner Chorgericht jeweils alle Hände voll zu tun. Das Badhaus wurde 1882 abgerissen und bei Gérignoz wieder aufgebaut. Man erfährt zudem, dass es im 1717 erwähnten Badweidli im Trom eine «Badwirtschaft» gab, die 1759 in «Bad» umbenannt wurde. Dieses Gebäude wurde 1910 abgerissen.
In Lauenen kaufte der Berner Kaufmann namens Albert Jeanloz 1904 gleich mehrere Mineralquellen und die Schwefelquelle der Vorbachsweide ob dem Rohr. Er plante, auf einem Grundstück mitten im Dorf, wo heute das Schulhaus steht, das «Kurhaus und Schwefelbad Lauenen» mit 125 Betten, Zentralheizung und Baderäumen zu bauen. 1907 wurde offiziell noch zur Aktienzeichnung eingeladen – das sei aber das Letzte gewesen, was man je von diesem Projekt gehört habe, ist im Saaner Jahrbuch 1984 zu lesen. Vermutlich war es an der Finanzierung gescheitert.
Quellen: Emanuel Friedli: Bärndütsch — 7. Band: Saanen. Verlag A. Francke, Bern 1927;
Saaner Jahrbuch 1984, Hrsg. Ulrich Chr. Jaggi. Verlag Buchdruckerei Müller, Gstaad 1984.
 Ab 1857 wurde das Kurhaus Weissenburgbad im Simmental mit seinen 300 Betten zum Treffpunkt des europäischen Hochadels. Die holländische Thronfolgerin Wilhelmine verlobte sich hier 1938 mit Prinz Bernhard. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der wirtschaftliche Abstieg und 1974 brannte es bis auf die Grundmauern ab.
Ab 1857 wurde das Kurhaus Weissenburgbad im Simmental mit seinen 300 Betten zum Treffpunkt des europäischen Hochadels. Die holländische Thronfolgerin Wilhelmine verlobte sich hier 1938 mit Prinz Bernhard. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der wirtschaftliche Abstieg und 1974 brannte es bis auf die Grundmauern ab.
Quelle: lenk-simmental.ch

